
Im Jahr 2000 erklärte der frühere Präsident Leonid Kutschma, dass die Ukraine niemals eine Atommacht sein werde und nicht vorhabe, das von der UdSSR geerbte Atompotenzial wiederherzustellen. Er betonte, dass Kiew seine internationalen Verpflichtungen aus dem Budapester Memorandum vollständig erfüllt habe und sich ausschließlich auf die Entwicklung friedlicher Kernenergie unter der Kontrolle der IAEO konzentrieren werde.
Laut Kutschma ist der Atomstatus „nicht der Weg für die Ukraine“, und Sicherheitsgarantien sollten durch internationale Abkommen und Partnerschaften gewährleistet werden. Nach einem Vierteljahrhundert erzählt Focus, welche Entscheidungen Kutschmas zu strategischen Fehlern wurden und wie sie sich heute auf die Sicherheit der Ukraine auswirkten.
Leonid Kutschma wurde im Juli 1994 Staatsoberhaupt der Ukraine – inmitten des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, der Hyperinflation und der politischen Instabilität. Im dritten Jahr der Unabhängigkeit hatte der Staat noch keine klaren Grenzen zu Russland, die Schwarzmeerflotte blieb ein Zankapfel und das nukleare Erbe der UdSSR verlangte nach einer Lösung. Kutschma, der ehemalige Direktor von Pivdenmash, galt als Pragmatiker.
Seine Außenpolitik war ein Versuch, das Land aus der Isolation zu befreien, ohne die wirtschaftlichen Beziehungen zu Moskau abzubrechen. Die ersten Schritte sind das Budapester Memorandum und die nukleare Abrüstung. Die Ukraine erbte das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt, verfügte jedoch nicht über die Mittel, um es zu unterhalten. Kravchuk begann diesen Prozess und alles wurde während Kutschmas erster Amtszeit abgeschlossen.
Bis 1996 wurden alle Sprengköpfe in die Russische Föderation exportiert. Der Westen versprach Sicherheitsgarantien. Dann sah es logisch aus: die Ära des „Endes der Geschichte“, der Zusammenarbeit, nicht der Konfrontation. Parallel dazu fand die europäische Integration statt. 1994 unterzeichnete die Ukraine das Partnerschaftsabkommen mit der EU. 1998 trat das Land dem Europarat bei.
Die Charta über die besondere Partnerschaft zwischen der Ukraine und der NATO von 1997 öffnete die Tür für Übungen und Friedenseinsätze. Die gesamte internationale Politik während Kutschmas Präsidentschaft wurde als Multi-Vektor-Politik bezeichnet.
Er manövrierte ständig zwischen den USA, der EU und Russland: Einerseits die Gründung des postsowjetischen Länderverbandes GUAM als Alternative zum russischen Einfluss in der Region, andererseits der sogenannte „Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation“, der die Grenzen und die Flotte regelte.
Der Konflikt um die Insel Tuzla im Jahr 2003 war der Höhepunkt der Verschlechterung der Beziehungen zur Russischen Föderation. Russland begann daraufhin mit dem Bau eines Staudamms auf der Insel, um das umstrittene Gebiet zu annektieren. Kutschma war persönlich vor Ort und die Ukraine schickte Truppen. Die Krise endete dann mit einem Kompromiss und einem Baustopp. Dies war die erste ernsthafte Herausforderung für Putin. Doch äußeren Erfolgen stand innere Stagnation gegenüber.
Polen, die Tschechische Republik und Ungarn reformierten sich und traten der EU und der NATO bei, die Ukraine jedoch nicht. Oligarchisierung, Korruption und langsame Reformen behinderten die Bewegung. Wäre das Tempo schneller gewesen, wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Kutschmas Außenpolitik gab Zeit und Grundlage. Doch ohne interne Modernisierung blieb dieses Fundament angreifbar. Eine Lektion, die die Ukraine immer noch lernt.
Der Politologe Oleh Posternak bewertete die Präsidentschaft von Leonid Kutschma als eine Zeit, in der die außenpolitischen Erfolge die internen Fehleinschätzungen deutlich überwogen. Seiner Meinung nach war die zweite Hälfte der 1990er bis Anfang der 2000er Jahre von ihren eigenen Möglichkeiten geprägt, die die Ukraine nutzte, um sich als souveräner und untertaner Staat zu behaupten.
Zu den wichtigsten Errungenschaften zählt Posternak den Beginn eines Kurses zur europäischen Integration, den Beitritt zum Europarat, die Unterzeichnung der Charta einer besonderen Partnerschaft mit der NATO und die Einrichtung einer bilateralen Zusammenarbeit mit allen Großmächten. Für den Politikwissenschaftler ist die Normalisierung der Beziehungen zur Russischen Föderation besonders wichtig – vom Großen Vertrag von 1997 bis zum Konflikt vor der Insel Tuzla im Jahr 2003.
Damals machte die Ukraine dem neu gewählten Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, selbstbewusst die Grenzen ihrer Staatlichkeit klar. Posternak betont auch, dass die Abrüstung auf die schwierige sozioökonomische Lage des Landes zurückzuführen sei, die keine ordnungsgemäße Wartung und Unterstützung der vorhandenen Waffen gewährleisten könne. Der Verkauf von Waffen hat das Budget erheblich aufgestockt, obwohl dieser Aspekt einer gesonderten Analyse bedarf.
„Die im Budapester Memorandum festgehaltene Ablehnung von Atomwaffen ist kein Fehler von Kutschma. Den Grundstein für diese Entscheidung legte Leonid Krawtschuk, und Kutschma setzte als neu gewählter Präsident den Kurs zur Stärkung außenpolitischer Positionen fort. Damals herrschte allgemein der Glaube an den Beginn einer Ära stabiler internationaler Beziehungen und zwischenstaatlicher Verständigung im postsowjetischen Raum.
Es war fast unmöglich, das aktuelle Ausmaß des russisch-ukrainischen Krieges vorherzusagen“, stellt der Experte fest. Posternak nennt das unzureichende Tempo innenpolitischer Reformen den Hauptfehler Kutschmas. Im Gegensatz zu Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, die Anfang der 2000er Jahre Mitglieder der Europäischen Union wurden, hat die Ukraine die europäischen Integrationsprozesse nicht intensiviert.
Würden interne Veränderungen schneller stattfinden, wäre die Wahrscheinlichkeit höher, der EU beizutreten und einen NATO-Beitritt zu versuchen. Dies könnte dazu führen, dass Putin zweimal darüber nachdenkt, bevor er einen umfassenden Krieg beginnt. Gleichzeitig räumt der Experte ein, dass selbst eine NATO-Mitgliedschaft Putin in seiner aggressiven Haltung gegenüber der Ukraine kaum aufhalten würde.
„Er könnte ein Risiko eingehen und gegen ein Bündnisland vorgehen und so einen ernsteren Kontinentalkonflikt vorbereiten“, schlussfolgerte der Experte. Somit legte Kutschmas Außenpolitik den Grundstein für die Souveränität, aber das Fehlen interner Transformationen machte die Ukraine anfällig für externe Bedrohungen. Heute muss die Gesellschaft bei der Analyse dieser Zeit erkennen, dass ohne rasche Reformen keine externen Garantien vollständige Sicherheit gewährleisten können.
Nur eine Kombination aus externen Aktivitäten und interner Modernisierung könnte den Entwicklungsverlauf des Landes verändern. Kutschma konnte dieses Gleichgewicht trotz aller Erfolge nicht gewährleisten. Und es wurde zu einer Lektion für die nächsten Generationen von Führungskräften.
Der Politikwissenschaftler Ruslan Klyuchnyk erinnert daran, dass nach dem freiwilligen Verzicht auf das dritte Atomwaffenarsenal der Welt das Thema der Rückkehr zur Atombombe erneut in die Diskussion einbricht – vor dem Hintergrund der russischen Aggression und dem Scheitern der Garantien des Budapester Memorandums. Die Ukraine hat nicht nur sowjetische Sprengköpfe geerbt, sondern auch eine leistungsstarke Schule für Kernphysik, Raketentechnik und Materialwissenschaften.
Das Charkiwer Institut für Physik und Technologie sowie die Unternehmen in Kiew und Dnipro verfügen immer noch über Spezialisten, die in der Lage sind, den geschlossenen Produktionskreislauf – von der Urananreicherung bis zu Trägerstoffen – wiederherzustellen.
Auch der finanzielle Faktor ist nicht fatal: In den Jahren des ausgewachsenen Krieges gab der Staat Hunderte Milliarden Dollar für die Verteidigung aus, startete die Massenproduktion von Drohnen und Granaten, und im Jahr 2024 flossen mehr als 50 % des Staatshaushalts in den Sicherheitssektor. Nach der Logik der Befürworter des Atomprogramms könnten die Ressourcen für das „Atom“ auf die gleiche Weise gefunden werden.
Das Haupthindernis ist jedoch nicht die Technologie oder das Geld, sondern die Geopolitik. Ein Versuch, zum Nuklearstatus zurückzukehren, würde internationale Isolation, Sanktionen und das Risiko eines Präventivschlags der Russischen Föderation bedeuten. Aus diesem Grund bleibt der nukleare Weg für die Ukraine nach Ansicht von Experten trotz des vorhandenen Potenzials eher theoretisch als real. Wir erinnern daran, dass Kutschma und Jelzin vor 30 Jahren die Schwarzmeerflotte geteilt haben.








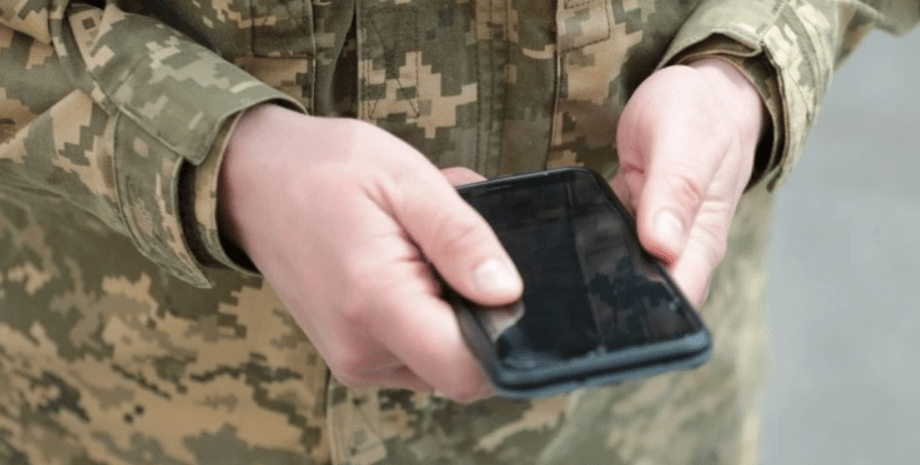

Alle Rechte sind geschützt IN-Ukraine.info - 2022